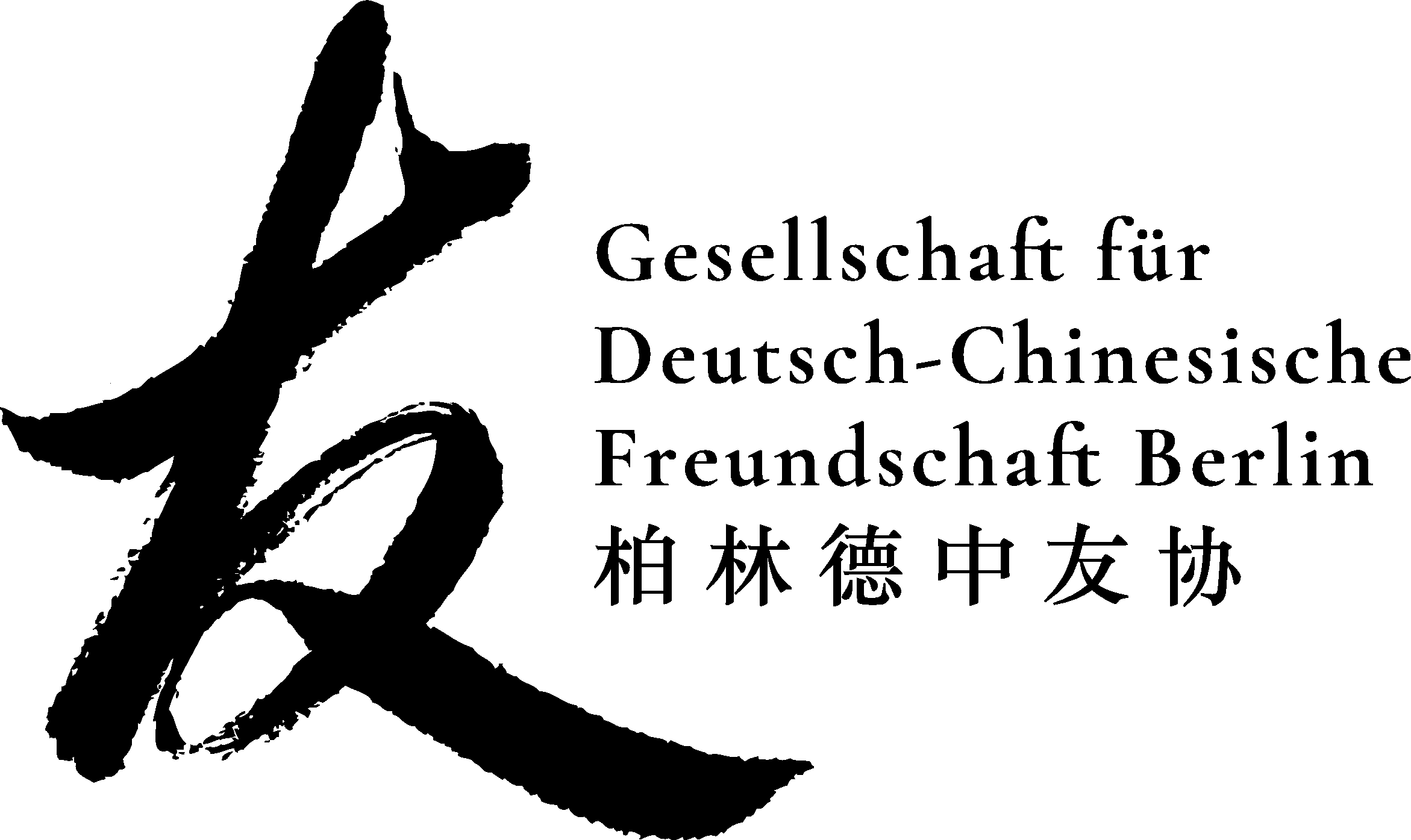Berlinale 2020: In diesen Zeiten …
Die diesjährigen 70.
Internationalen Filmfestspiele
fanden unter neuer künstlerischer
und organisatorischer Leitung
(Carlo Chatrian und Mariette
Rissenbeek) statt und standen daher
bereits im Vorfeld unter besonderer
Beobachtung. Die Bedingungen für
das neue Team waren alles andere
als günstig: Mehrere Spielstätten
und Veranstaltungsorte konnten
nicht genutzt werden, der
Presseraum war anderweitig
vermietet, langjährige Sponsoren
hatten gewechselt und die Rolle
Bauers in der NS-Zeit führten zu
Diskussionen über die Geschichte
der Berlinale.
Diskutiert wurde natürlich über die
Auswahl der Beiträge im Wettbewerb,
die thematisch insgesamt sehr
düster ausfielen. Dieser Kritik
begegnete Mariette Rissenbeek mit
der Erklärung, dass Film nun mal
Teile der gesellschaftlichen
Realität abbilde. Die Auswahl im
Wettbewerb wurde zudem von
europäischen Beiträgen
(italienischen) und Ko-Produktionen
bestimmt, daneben gab es lediglich
einen Film aus Taiwan („Rizi“, Days
von Tsai Ming-Liang) und den
koreanischen Beitrag (The Woman Who
Ran – offenbar im Kontext der
Oscar-Prämierung von
„Parasite“).
So fand ein Teil der interessanten
Produktionen in den anderen
Sektionen wie auch der neu
eingerichteten Sektion „Encounters“
statt. Auch hier gab es nur wenige
Filme aus China. Nach Auskunft der
chinesischen Filmindustrie konnte
ein Teil der Werke, die
traditionell zum Neujahrsfest
erscheinen, wegen des Corona-Virus
und den damit verbundenen
wirtschaftlichen Folgen nicht
rechtzeitig fertiggestellt werden.
So richtete sich der Blick auf all
die Produktionen, die meist nur
geringe Chancen auf ein größeres
Publikum erhalten und mit Glück im
Fernsehprogramm der Dritten
gesendet werden. Vermutlich so wie
„Schwarze Milch“ (Black Milk).
Leben zwischen den Kulturen

Der Film erzählt von zwei
Schwestern, die in
unterschiedlichen Welten
aufgewachsen sind und die mit den –
wie ich finde – peinlichen Namen
Wessi und Ossi benannt wurden. Die
ältere lebt seit Jahren im Westen,
in einer deutschen Großstadt. Sie
ist mit einem Deutschen liiert und
möchte nach Jahren ihre Schwester
in der mongolischen Steppe
besuchen. Bei ihrer Ankunft wird
sie wie die verlorene Tochter vom
Vater mit einem großen Fest mit der
ganzen Familie und allen Nachbarn
in der Jurte willkommen geheißen.
Es wird gegessen und getrunken,
gelacht und geredet.
Bald entdeckt Wessi allerdings,
dass ihre Vorstellungen von
ungezwungener Freiheit in den
Weiten der Steppe keineswegs der
Realität entsprechen. Das Leben
ihrer Schwester bedeutet harte
körperliche Arbeit, und eine
traditionelle Männerwelt grenzt ein
freiheitliches Leben für Frauen
ein. Während die eine von
ägyptischen Königinnen erzählt, die
sich für ihre Schönheit in
Ziegenmilch baden, zeigt ihr die
andere den Alltag beim Holzhacken
und dass Tiere erst geschlachtet
werden müssen, ehe man das Fleisch
essen kann. Auch Wessis erotische
Beziehung zu einem mysteriösen
alleinstehenden Nomaden, der
außerhalb der traditionellen Normen
zu leben scheint, scheitert an den
Tabus einer in sich geschlossenen
Gemeinschaft. Als sie erkennt, dass
sie sich niemals dieser
tabuisierten Traditionen entziehen
kann, kehrt sie dem mongolischen
Leben den Rücken und reist in die
westliche Heimat zurück.
Die halb-autobiografische Story
basiert auf Erfahrungen der 1984 in
der Mongolei geborenen Regisseurin
Uisenma Borchu. Mit vier Jahren kam
sie mit ihrer Familie in die DDR.
Sie studierte zunächst Sprachen in
Mainz und danach an der HFF München
Dokumentarfilm. „Black Milk“ zeigt:
In beiden Welten sind individuelle
Freiheiten von Frauen
eingeschränkt. Für ein
selbstbestimmtes Leben – auch der
deutsche Freund entscheidet über
das gemeinsame Zusammensein – gibt
es enge Grenzen.
In Traditionen gefangen
Der von Ray Yeung in Hongkong gedrehte Beitrag „Suk Suk“ erzählt von der späten Liebe zwischen zwei älteren Männern, deren Alltag vom Leben in ihren Familien bestimmt ist. Die Tage vergehen in der üblichen Routine. Nun arbeiten sie nicht mehr und haben viel Zeit. Sie gehen spazieren und entdecken ihre lange Jahre verdeckten sexuellen Wünsche und Gefühle.

Die Story des Films basiert auf
einer Sammlung von Interviews mit
Hongkongern, die in den 1960er- bis
1980er-Jahren ihre Homosexualität
hinter der Fassade bürgerlicher
Familien verbergen mussten.
Ausgehend von diesem
dokumentarischen Material
porträtiert der Regisseur zwei
Männer, die sich nach einem
arbeitsreichen Leben – einer war
Taxifahrer – aus der Normalität des
Familienlebens langsam aufeinander
zu bewegen. Die „Großväter“ wollen
sich ihrem Wunsch nach intimer Nähe
nicht entziehen. So wird ein
Badehaus der heimliche Treffpunkt.
Doch immer wieder schrecken sie in
ihrem neuen Leben voller
Heimlichkeit, innerer Kämpfe und
schlechtem Gewissen ihren Familien
gegenüber vor den Folgen
zurück.
Der fast dokumentarische Film wurde
in nur 21 Tagen mit einem Etat von
lediglich 1 Mio. Dollar gedreht.
Ray Yeung, Drehbuchautor und
Regisseur, enthält sich jeder
moralischen Vorgabe und überlässt
es den Zuschauern, das Verhalten
der Männer zu beurteilen. Aus
heutiger Sicht (und für ein
westliches Publikum) ist die
Zurückhaltung und verständnisvolle
Rücksichtnahme der beiden
Protagonisten gegenüber den
repressiven Familienstrukturen
nicht leicht nachzuvollziehen. Zu
konventionell ist der
Ausbruchsversuch der beiden
„Großväter“ filmisch umgesetzt.
Leider fehlt dem in Hongkong bis
heute brisanten Thema eine mutige
Bildwelt.
Suche nach friedlichen Gestaden
Gefördert vom anerkannten Regisseur und Produzenten Jia Zhang-ke sowie der Pekinger Huanxi Medien Produktion stellte die junge Filmemacherin Song Fang ihren jüngsten Beitrag in der Sektion Forum vor. Song studierte in Belgien und an der Pekinger Filmakademie und hat sich 2009 mit ihrem Kurzfilm „Gao bie“ (Good-bye) in Cannes einen Namen gemacht. Ihr Spielfilm „Ping jing“ (平静, The Calming) besticht mit ihrer ruhig dahinfließenden Erzählstruktur, die uns mit der Protagonistin von Peking nach Tokio, Nanjing und Hongkong bringt. Lin ist eine Dokumentarfilmerin in den frühen Dreißigern. Nach der offenbar schmerzlichen Trennung von ihrem langjährigen Freund versucht sie ihre erstarrte Gefühlswelt durch ständiges Herumreisen wiederherzustellen.

In langen, extrem ruhigen
Kameraeinstellungen begleiten wir
die Protagonistin (Darstellerin Qi
Xi), durch das Vergehen der
Jahreszeiten. Aus dem in Schnee
erstarrten Tokio, wo sie an einem
Filmfestival teilnimmt, kehrt sie
nach Peking in eine neue Wohnung
zurück. Auch hier ist sie in Stille
und Einsamkeit gefangen, fährt zu
ihrem erkrankten Vater nach Nanjing
und besucht eine alte Freundin. Im
Sommer reist sie nach Hongkong, wo
sie im üppigen Grün der Inselwelt
Ruhe sucht. Wie die zarten Verse
eines langen Poems klingen ihre
Gedanken. Es ist die Hoffnung nach
einem friedlichen Ort – „convey me
to a peaceful shore“ – , an dem sie
innerlich Ruhe finden kann. Dort
wird sie sich ihre Einsamkeit und
Verlassenheit eingestehen. Sie muss
sich nicht mehr hinter
nichtssagenden Gesprächen
verstecken.
Kleiner Nachtrag: Während der
Berlinale kam mir der Film ein
bisschen manieriert vor. In diesen
Zeiten erscheint mir das Thema von
Einsamkeit und Stille nun in einem
ganz neuen Licht.

Auch in „Rizi“ (einer Produktion aus Taiwan) von Tsai Ming-Liang geht es um Einsamkeit. Der 1957 in Malaysia geborene Filmemacher, Theaterautor und Bildende Künstler hat seit den 1990er-Jahren mehrfach seine Arbeiten auf der Berlinale präsentiert. Bekannt wurde er mit Werken wie „Rebels of the Neon God“ und „The River“ (Silberner Bär 1997) oder „Xi You“ (Reise in den Westen, 2014). In seinem jüngsten Werk, das fast ganz ohne Dialoge auskommt, treffen zwei in ihrem Schmerz gefangene, entwurzelte Männer in einem Hotelzimmer aufeinander. In den unendlich langen Bildern bleibt die Einsamkeit zwischen Kang (Lee Kang-Sheng) und Non gefangen. Als Zuschauer erahnen wir in diesen vom Licht der Kamera eingefangenen Gesichtern nur ein Stück dieses Schmerzes, der für eine kurze Begegnung eine eigene Realität jenseits des Alltags erhält.
Blick zurück ohne Zorn
1998 lief Jia Zhang-kes Debütfilm „Xiao Wu“ (Taschendieb) in der Sektion Forum der Berlinale. Seither wurde der in Fenyang (Provinz Shanxi) geborene Filmemacher mit mehreren Dokumentar- und Spielfilmen, in denen er sich mit klugem Blick seiner Heimat zuwendet, international ausgezeichnet: „Still Life“ (2006), „A Touch of Sin“ (2013), „Ash is Purest White“ (2018). Sein jüngstes Werk „Swimming Out Till the Sea Turns Blue“ (一直游到海水变蓝) spielt ebenfalls in der Heimatregion des Regisseurs und ist als dokumentarische Erzählung angelegt.

In achtzehn Kapiteln werden
Schriftsteller unterschiedlicher
Generationen mit ihren Geschichten,
Erzählungen und Gedichten vor dem
Hintergrund der chinesischen
Gegenwartsgeschichte porträtiert.
Neben drei anerkannten
Protagonisten Jia Pingwa (Jg.1952),
Yu Hua (Jg. 1960) und als Jüngste,
die Autorin Liang Hong (Jg. 1973),
sprechen weitere – nicht alle
außerhalb des Landes bekannte
Literaten – über den Einfluss
Chinas jüngerer Geschichte auf ihre
Arbeit und ihr Leben. Existenzielle
Themen wie Essen, Liebe, Alter,
Familie, Trennung und Heimkehr
schaffen Verbindungen zwischen den
unterschiedlichen politischen
Erfahrungen.
Zu Beginn der dokumentarischen
Erzählung, deren Geschichten sich
wie Perlen auf einer Kette
aneinanderreihen, begegnen wir den
alten Menschen aus Jias Heimatort.
Es ist die Zeit nach der Gründung
der Volksrepublik. Stumm stehen die
Dorfbewohner an der Essensausgabe,
sie reichen ihre Schalen an die
Helfer und beginnen schweigend zu
essen. Es ist der Schriftsteller
und Funktionär Ma Feng, der von dem
dörflichen Leben nach dem Krieg
erzählt. Bei ihm ist es die Zeit
des Neuanfangs, der Solidarität und
des Einsatzes gegen überkommene
Traditionen. Diese Generation habe
gegen die von Eltern arrangierten
Ehen gekämpft und sich gemeinsam
mit einfachsten Mitteln für
sauberes Wasser eingesetzt. Mas
positiven Blick durchbricht der
Autor Jia Pingwa, dessen Leben von
politischen Kampagnen und den
Folgen der Kulturrevolution
bestimmt wurde. Es ist
überraschend, wie offen der Autor
über diese Zeit berichtet, eine
Zeit, die in China bis heute selten
öffentlich so mutig kritisiert
wird. Seine Geschichte beginnt mit
dem Vater, der durch einen absurden
Zufall zum Konterrevolutionär
abgestempelt wurde. Es folgten
Inhaftierung, zehn Jahre
Arbeitslager und Bestrafung der
gesamten Familie. Nach der üblichen
Landverschickung konnte Jia Pingwa
erst 1978 seine literarische Arbeit
als Dichter aufnehmen. Verlorene
Zeit.
Der nur wenige Jahre später
geborene Autor Yu Hua hat seine
Erfahrungen der KR in mehreren
literarischen Werken verarbeiten
können. Nach fünf Jahren, in denen
er als Zahnarzt tätig war, erschien
sein erster Roman 1991 in der
Zeitschrift Shouhuo. „Leben!“ wurde
von Zhang Yimou verfilmt und trug
damit zur weltweiten Anerkennung
des Autors bei.
Wie sich der gesellschaftliche
Wandel vom Neuanfang, über die
Kulturrevolution bis zur
Reformpolitik auf die Literatur
auswirkt, zeigte sehr bewegend das
letzte Porträt. Liang Hong, die
1997 an der Universität in
Zhengzhou ihren Abschluss machte,
musste den Rückblick auf ihr Leben
während des Interviews immer wieder
unterbrechen. Die Erinnerungen an
ihre Kindheit und Jugend, an ihre
Mutter und das Schicksal der
gesamten Familie ließen lang
verdrängte Emotionen hervorbrechen.
Im Gegensatz zu den älteren
Schriftstellern gilt Liang als
Vertreterin der sogenannten
dörflichen Literatur. In ihren
Erzählungen, jenseits der urbanen
Zentren, widmet sie sich der
ländlichen Lebenswirklichkeit,
ihrer Eltern und Familien. In dem
sehr persönlichen Gespräch wurde
deutlich: Das Leben dieser Menschen
gleicht dem Hinausschwimmen auf das
weite Blau des Meeres. Obwohl Jia
Zhang-kes Filmerzählung durch die
Betonung heller Lichtblicke
bestimmt wird, fehlt seinem
jüngsten Werk ein klares
übergeordnetes Konzept. So
hinterlässt der Film einen
insgesamt allzu zusammengewürfelten
Eindruck.
Grenzüberschreitungen
Neben Jia Zhang-ke vertrat der junge Filmemacher Meng Huo (Jg. 1984) mit seinen Film „Crossing the Border“ (Guo Zhao Guan 过赵关) auf der Berlinale eine neue Generation chinesischer Regisseure. Sein erster langer Spielfilm aus dem Jahr 2018 ist eine liebenswerte Hommage an seinen Großvater. Der Film gleicht Erinnerungen wie in alten Volksliedern. Erzählt wird von dem siebenjährigen Ning Ning (Yunhu Li). Der muss die Sommerferien bei seinem Großvater Li Fuchang (Yang Taiyi) auf dem Land verbringen, weil seine Mutter täglich die Geburt eines zweiten Kindes erwartet und der Vater keine Zeit für den Jungen hat.

Über das dörfliche Landleben,
ohne seine Freunde und die üblichen
Chatmöglichkeiten und Gamespiele,
ist der Enkelsohn nicht gerade
begeistert. Doch kurz darauf
beginnt für Ning Ning eine
aufregende Zeit. Der Großvater
beschließt einen alten Freund, der
nach einem schweren Schlaganfall
tausende Kilometer entfernt im
Krankenhaus liegt, zu besuchen. Im
Stil eines klassischen Road Movies
begeben sich die beiden auf einem
kaum fahrtüchtigen Motorgefährt auf
die Reise. Auf der Fahrt begegnen
sie einem einsamen jungen Mann, der
für sich keine Zukunft sieht, einem
Fernfahrer, der mit seinem Lkw mit
einer Panne am Rand der Straße
gestrandet ist und einem alten
Mann, der seine Ruhe und
Gelassenheit als Imker gefunden
hat. Bei all diesen Begegnungen
lernt der Enkelsohn etwas über den
Umgang als Mensch mit den
Ambivalenzen des Lebens. Auf ihrem
Weg zu dem schwerkranken Freund
geht es in den Gesprächen des
Großvaters um Erinnerungen an
frühere Zeiten und um das, was nach
dem Tod bleibt. Im Gegensatz zu den
engen Lebensvorstellungen und
scheinbar geregelten Alltag seines
Vaters erlebt Ning Ning mit dem
eigenwilligen Großvater, der sich
auch vor Grenzüberschreitungen
nicht scheut, von der Fülle
möglicher Lebenskonzepte.
Der Regisseur hat „Guo Zhao Guan“
dem Leben seines taubstummen
Großvaters gewidmet, der nie mehr
als zehn Kilometer von seinem
Heimatort entfernt war und dennoch
so viel vom Leben und vom Tod
verstanden hat. Sein Film erzählt
in klaren, poetischen Bildern vom
Alltag eines ländlichen China, das
meist vergessen wird. Meng Huo
versteht seine Filmarbeit in der
Tradition des Kinos und als Kunst
der Erinnerung, die all denen eine
Stimme gibt, die keine Stimme
haben. Ihm ist ein zutiefst humanes
Werk gelungen.
Dagmar Yu-Dembski