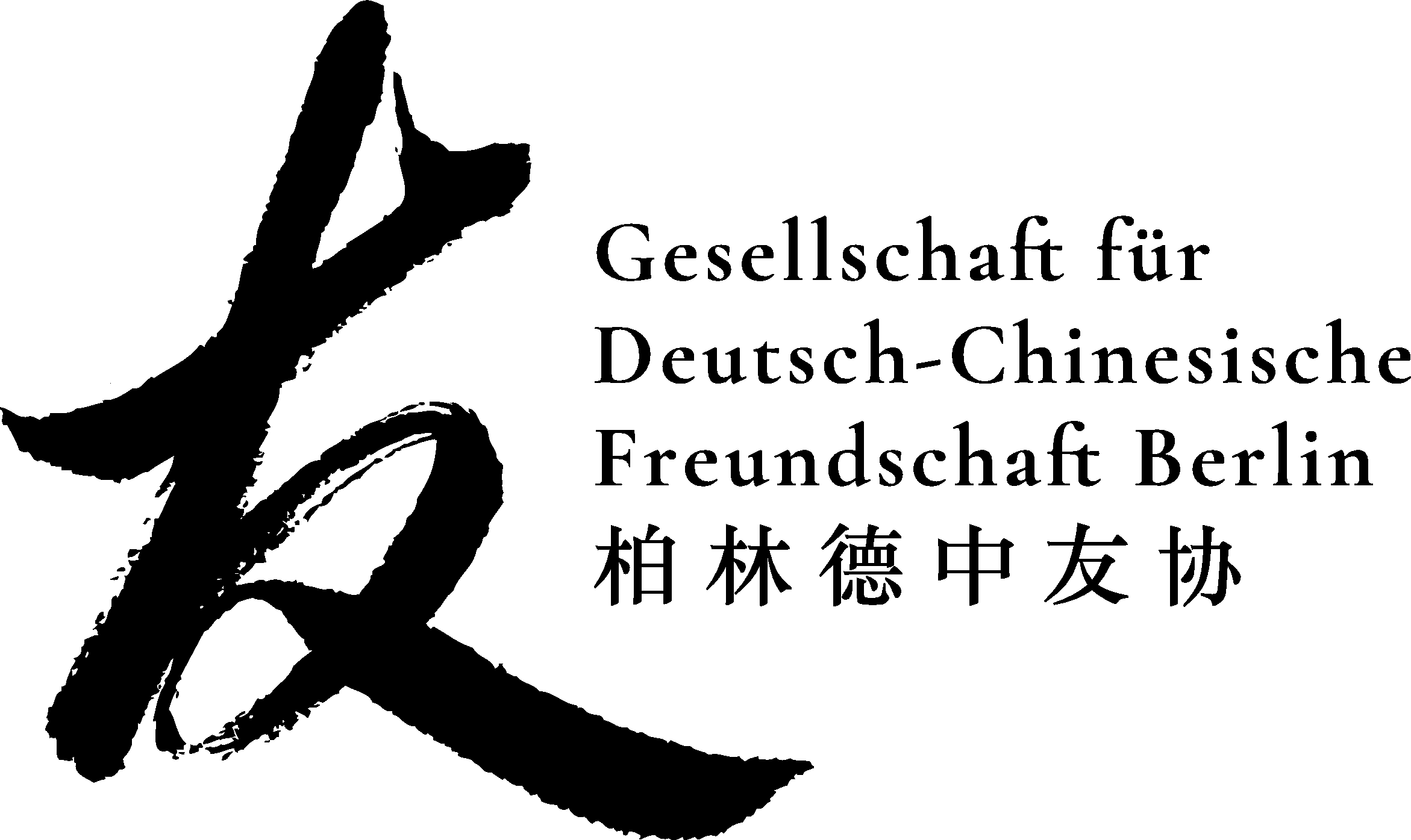Zhang Yimou: „Eine Sekunde“
Auf der 69. Berlinale 2019, der letzten unter der Leitung des langjährigen Direktors Dieter Kosslick, war für den letzten Tag des Festivals „Eine Sekunde“ (Yi miao zhong 一 秒 钟) angekündigt. Titel, Plakat und Inhaltsangabe lagen bereits vor. Dann wurde der Beitrag des chinesischen Filmregisseurs Zhang Yimou kurzfristig abgesagt. Die offizielle Begründung lautete: Probleme mit der Postproduktion. Inzwischen sind mehr als zwei Jahre vergangen und nach einer Preview am Sonntag, dem 16. Juli 2022 ist der Film nun in einigen Berliner Kinos zu sehen. Wer weiß, wie lange noch?
Zhangs jüngster Film (2020) erzählt von der Faszination des Kinos und der politischen Bedeutung seiner Bilder. Er spielt zur Zeit der Kulturrevolution, in China offiziell als die zehn Jahre des Chaos bezeichnet, und basiert auf einer Episode des Romans „The Criminal Lu Yanshi“ von Yan Geling. Bereits einige Jahre zuvor hatte ihre Erzählung für den Film „Coming Home“ (2014 mit Gong Li) die Basis ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit gebildet. Nun ist in der jetzigen Filmfassung der Hinweis auf Yan als Drehbuchautorin aus den Credits gestrichen worden. Nach Zensurvorwürfen und Protesten verweist die Leitung der Yorck-Kinos in einem eigenen Vorspann auf den Beitrag am Drehbuch der in Berlin lebenden Autorin.
Zensureingriffe und Änderungen waren zu erwarten. Schließlich spielt der Film in einer brisanten Zeit. Ein Häftling (Yi Zhang), der aus einem Umerziehungslager nördlich der Wüste Gobi geflohen ist, ist auf der Suche nach einer kurzen Sequenz einer Wochenschau. Dort soll vielleicht seine Tochter zu sehen sein. Genau auf diese Filmrolle hat es auch ein umherziehendes Waisenmädchen (Liu Haocun) abgesehen. Sie braucht den Zelluloidstreifen, um für den jüngeren Bruder einen Lampenschirm zu basteln. Doch bei ihrer Ankunft in dem entlegenen Wüstenort sind die Filmrollen bereits auf dem Weg in die nächste Ortschaft, wo die Dorfbewohner auf die Vorführung warten.
Zwischen den beiden ungleichen Protagonisten beginnt nun ein bizarrer Wettkampf um eine dieser Filmrollen. Unterwegs auf Schotterwegen und steinigen Endlosstraßen entwickelt sich zwischen dem hartgesottenen Häftling und dem gewitzten Waisenmädchen eine Auseinandersetzung, die sie letztlich nur gemeinsam gewinnen können. Als sie schließlich in dem nächsten Ort der Vorführung ankommen, liegen die Filmrollen verschmutzt und in verheddertem Durcheinander auf der Dorfstraße. Der örtliche Parteifunktionär Fan hat jedoch den parteipolitischen Auftrag, den Dörflern den revolutionären Hauptfilm „Heroische Söhne und Töchter“ vorzuführen, zu dem die aktuelle Wochenschau die politische Einordnung liefert. Daher ruft er zu einer kollektiven Aktion aller Frauen und Männer des Dorfes auf, an der sich auch die beiden Protagonisten aus unterschiedlichem Interesse beteiligen. Die verdreckten und in sich verschlungenen Zelluloidstreifen werden vorsichtig gereinigt, entwirrt und durch sanftes Fächerwedeln getrocknet. Mit der gemeinsamen kollektiven Anstrengung gelingt es Fan, dem lokalen Politfunktionär und fanatischen Filmvorführer, den revolutionären Streifen und die kurze Sequenz der Wochenschau zu retten.
Zhang Yimou ist mit „Eine Sekunde“ nach seinen Ausflügen in die Blockbuster-Welt der Martial Arts wieder zurückgekehrt zu seinen filmischen Anfängen. In seinen frühen Werken (Das rote Kornfeld) hatte er sich auch als Kameramann (Gelbe Erde) mit farbgewaltigen Bildern als Begründer des modernen chinesischen Kinos profiliert. In „Eine Sekunde“ folgt die Kamera nun dem Wind und Staub des gelben Wüstensands. Es sind Geschichten der einfachen Menschen im ländlichen China, die in politisch wirren Zeiten zu überleben versuchen. Kein Wunder, dass sein Film, der von der Macht der Bilder und dem trotzigen Widerstand seiner ländlichen Bewohner erzählt, nicht ohne Auflagen gezeigt werden konnte. Angeblich geht es um eine Minute, die geändert wurde. Vielleicht lediglich um eine Sequenz von 60 Sekunden. Trotzdem: unbedingt ansehen!
Dagmar Yu-Dembski
Ab 16. September 2022 soll der Film auf dem Filmportal des Verleihs Mubi zu sehen sein. Im Moment noch in einigen Berliner Kinos der Yorck-Gruppe.
Nachruf
Jochen Noth ist am 22. April 2022 gestorben. Wie viele Freunde er hatte, erfuhren wir erst, als er diese Welt verlassen hatte. Er war jahrelang Mitglied der GDCF und brachte sich mit seiner Chinaerfahrung und Kompetenz zu Kultur, Politik und Wirtschaft Chinas in die Redaktionsarbeit der Zeitschrift „das neue China“ ein. Nicht immer waren wir einer Meinung. Doch nie wurden die Diskussionen unversöhnlich. Immer stand das gemeinsame Interesse im Vordergrund: das Verständnis für das Hier und Dort, den gemeinsamen Austausch.
Als Jochen in den Achtzigerjahren in Peking lebte, befand sich China im Aufbruch. In seiner Pekinger Wohnung hatte er einen Kreis von Künstlern, Malern und Musikern um sich versammelt, die er später nach Berlin holen sollte. 1993 öffnete im Haus der Kulturen der Welt die Ausstellung „China Avantgarde“, die erste große Ausstellung unabhängiger Gegenwartskunst in Europa – geplant und organisiert von Jochen Noth in Zusammenarbeit mit Hans van Dijk. Es war eine seiner kulturellen Aktivitäten, wirtschaftliche und gesellschaftliche sollten folgen.
Bei der Trauerfeier im Mai kamen so viele Erinnerungen zusammen, persönliche, berufliche und politische, die zeigten, wie sein ganzes Leben mit China verwoben war. Immer wieder nahm er neue Aktivitäten an. Chinas politische Umwege und Rückschritte konnten ihn nicht an seiner Verbundenheit zum Land und seinem Engagement hindern. Häufig kam er in unseren Buchladen, um sich über neue Publikationen zu China auszutauschen. Bereitwillig teilte er mit uns seine Lektüreerfahrungen. Diskutierte und kommentierte mit Begeisterung und Kompetenz. Jochen, wir werden dich vermissen.
Was bleibt ist, die Erinnerung an einen großzügigen Menschen, der das Leben liebte. Auch wenn er nicht alle seine Träume verwirklichen konnte, hatte er trotz allem mit seiner Familie und den vielen Freunden sein Glück gefunden.
Dagmar Yu-Dembski
Ein Gefühl der Fremdheit
„Wovon wir träumen“, vom Piper Verlag als Roman publiziert, kann wie ein Band im klassischen China von hinten nach vorn gelesen werden. Unter der Überschrift „Anfang“ beendet die Autorin Lin Hierse ihre Gedanken und Erinnerungen, während die ersten Seiten des Buchs unter dem Thema „Abschied“ beginnen. Hier nimmt uns die Autorin mit nach China, zu der Trauerfeier für die chinesische Großmutter Abu. Gemeinsam mit der zahlreichen Verwandtschaft geht die Reise im gemieteten Bus von Shanghai aus nach Shaoxing, einer einst malerischen Kleinstadt südlich von Hangzhou. Aus der flirrenden Metropole am Ufer des Yangzi und ihren miteinander um die Höhe wetteifernden Hochhäusern, den sich über und untereinander kreuzenden Schnellstraßen und der modisch westlichen Großstadtjugend.
Auf der langen Fahrt kann Lin den Erinnerungen an die Besuche bei ihren Cousins und Cousinen, den zahlreichen Onkeln und Tanten nachhängen, als sie in der Kindheit mit ihrer Mutter aus Deutschland angereist war. Für die Mutter, die Shaoxing verlassen hatte, um in Deutschland ein neues Leben zu beginnen, war jeder Besuch ein erneuter Abschied. Eine Rückkehr dorthin, wo sie ihre Träume verwirklichen wollte.
Dieses Leben schildert die Autorin in immer anderen Facetten und aus anderem Blickwinkel. Rätselt über das besondere Verhältnis von Mutter und Tochter (und umgekehrt), aus dem es keine Flucht gibt. Hierse erkundet ihr eigenes Leben, das in Deutschland von einem unbestimmten Gefühl der Fremdheit geprägt ist. Ebenso wie ihre Mutter die Erinnerungen an das Leben in China stets mit sich trägt, fühlt die Tochter doppelt an dem Fremdsein. Sie fragt sich, welchen Namen die Mutter ihr gegeben hat. Es ist kein poetischer Name wie bei ihren Tanten. Sie tragen alle – wie die Mutter – das Zeichen Mond im Vornamen. Ihrer klingt eher pragmatisch schlicht, für die deutschen Behörden ausgewählt, vermutet sie.
In ihren Erinnerungen sucht Lin Hierse, 1990 in Deutschland geboren als Tochter einer deutsch-chinesischen Ehe, nach einem eigenen Platz und einer eigenen Identität zwischen den verschiedenen Welten. Sie hat in Braunschweig Asienwissenschaften studiert und streut in ihrem Text ab und an Redewendungen in Chinesisch ein. Seit 2019 arbeitet sie als Redakteurin bei der „tageszeitung“ (taz), wo sie in ihrer Kolumne „Poetical Correctness“ zu aktuellen Ereignissen Stellung bezieht. So durchziehen die autobiografisch fiktionalisierten Erinnerungen auch verschiedene Erfahrungen und Begegnungen aus dem deutsch-chinesischen Alltag. Mit „Wovon wir träumen“ hat Lin (und vielleicht mit dem Zeichen der weißen Jade im Vornamen) sich nicht nur auf den Weg zu dem Mutter-Tochter-Verhältnis begeben, sondern auch der chinesischen Community in Deutschland eine junge, poetische Stimme verliehen.
Dagmar Yu-Dembski

Wovon wir träumen.
Roman
Lin Hierse
Piper Verlag (2022)
240 Seiten, 18,00 €
Eine Rückkehr in die Zeit der Kindheit
Bei Daos Erinnerungen an seine Kindheit beginnen im Sommer, den er das Reich der Grillen und Zikaden nennt. Für ihn ist es die Zeit, die seine Träume kreisen ließ. Der 1949 geborene Dichter, einer der bedeutendsten Autoren der chinesischen Gegenwartsliteratur, nimmt uns in „Das Stadttor geht auf“ ein Stück des Wegs mit in die Kindheit seiner Heimatstadt Peking.
Nach 13 Jahren im Exil in Europa und den USA erhält der Heimatlose im Jahr 2001 für einige Monate die Erlaubnis, in die Stadt seiner Kindheit heimzukehren. Um den todkranken Vater noch einmal zu besuchen. Daher lässt Bei Dao sein Buch mit einer persönlichen Erinnerung an „Mein Peking“ beginnen. Es ist ein Peking, das es längst nicht mehr gibt, und das er aus seiner Vergangenheit wieder hervorholt, indem er die Zeit rückwärts laufen lässt. Für all die einsamen Seelen, die kein Heim mehr haben, öffnet der Dichter das Stadttor weit auf und lädt uns ein, gemeinsam mit ihm in die Wirnisse des Lebens der 1950er- und 60er-Jahre einzutauchen.
Sein Kindheitsblick auf verlorene Zeiten ist keine nostalgische Rückschau, eher ein Kaleidoskop voller blitzender Farben, von Hell und Dunkel, vom Wechsel von Licht und Schatten. In jeder Episode entwirft Bei Dao eine Welt voller sinnlicher Erfahrungen, von Klängen und Gerüchen, von jugendlichen Hoffnungen und Enttäuschungen. Die Schilderungen einer Kindheit in Peking lassen durch Bei Daos Liebe zur Sprache und seine Feinheit der Beobachtung eine Zeit gesellschaftlicher Realität entstehen, die vom Aufbruch aus der Kindheit und dem Suchen nach einem selbstbestimmten Leben erzählt. Seine bildreichen Geschichten erzählen von pubertärem Übermut und überbordenden Hoffnungen.
Stets schwingen die politisch schwierigen Zeiten mit. Sie prägen das ambivalente Verhältnis zu dem geliebten, Vater. Bei Dao scheut sich nicht, die eigenen politischen Irrwege aufzuzeigen. Wenn er von den immer neuen Kampagnen erzählt, dem Kampf zur Ausrottung der Spatzen, von der Faszination der Kunst, vom Entdecken verbotener Bücher und Schallplatten oder sich vom viel zu hohen Sprungturm ins Wasser stürzt, um den Mädchen zu imponieren. Vom Dahintreiben beim Schwimmen, Atemanhalten in der Waschschüssel und von dort zum Schwimmbad und dem Wellengang im Wasser des Sommerpalasts.
Es ist eine Zeit, in der seine Liebe zu Kultur entsteht. Wenn er beschreibt, wie er das Kino für sich entdeckt, die kurze Phase der Dunkelheit, ehe der Film beginnt, die seine Assoziationen und Erwartungen entstehen lässt, von den Unterbrechungen, wenn der Film mal reißt und dem Geräusch beim Zurückspulen des Zelluloids. Es sind diese Geschichten, die Bei Dao mit einer wunderbaren Leichtigkeit in poetische Bilder verwandelt. (Und natürlich in gewohnt großartiger Übertragung von Wolfgang Kubin.)
Wer selbst eine Zeit lang in Peking (auch in China) verbracht hat, wird sich an das morgendliche Fahrradklingeln erinnern, an den Geruch von trocknendem Chinakohl im Herbst und dem drückenden Smog der Kohleöfen im Winter. Nur dass Bei Dao dies alles in seiner einmaligen Bildsprache viel besser zum Leben erweckt. Oder, um es mit dem 1988 in Saigon geborenen Ocean Vuong zu sagen, Bei Daos Leben und Werk sind „der Inbegriff der Dichtung: zeitlos schimmernd.“ Statt einer Besprechung des Werks möchte ich es lieber mit seinen Worten empfehlen: „So öffne ich denn das Stadttor und heiße … die einsamen Seelen willkommen, die kein Heim mehr haben, heiße alle neugierigen Reisenden willkommen.“
Dagmar Yu-Dembski

Das Stadttor geht auf.
Eine Jugend in
Peking
Bei Dao
Hanser Verlag (2021)
336 Seiten, 25,00 €
Taiwan, die Ukraine von morgen?
Verbringst Du irgendwo eine Woche, schreibst Du einen Artikel. Bleibst Du einen Monat, verfasst Du einen Aufsatz. Bleibst Du ein Jahr, veröffentlichst Du nichts mehr: Die Fragestellungen werden komplexer, die Antworten komplizierter. Die in der Schweiz lebende Sinologin und Autorin Alice Grünfelder verbrachte 2020 ein halbes Jahr auf der „Ilha Formosa“ (Der schönen Insel), wie sie die Portugiesen im 16. Jahrhundert nach ihrer Entdeckung nannten. Nun legt sie ein klug gestaltetes Buch mit dem aussagestarken Titel „Wolken über Taiwan. Notizen aus einem bedrohten Land“ vor.
1886 erhält Taiwan den Status einer Provinz Chinas – und das genau ist der Fakt, auf den sich die Übernahmephantasien eines Xi Jinping in unseren kriegslüsternen Zeiten berufen. Der kleine Inselstaat im Pazifischen Ozean, hierzulande vor allem als führender Chiphersteller bekannt, steht schon sehr lange auf der „Wunschliste der Wiedervereinigung mit dem übermächtigen Mutterland China“. Für Insider ist es wohl nur eine Frage der Zeit, dass China die Entwicklung des gegenwärtigen Überfallkriegs in Europa genau observiert, um in einen günstigen Augenblick die Insel ins gigantische Mutterland „einzuverleiben“: Taiwan könnte zur Ukraine von morgen werden.
Durch den durchgesetzten Alleinvertretungsanspruch Chinas tritt Taiwan 1971 aus der UNO aus. In den 1980er-Jahren nimmt ein unaufhaltsamer Demokratisierungsprozess Fahrt auf, der der Volksrepublik China seit jeher ein Dorn im Auge ist. im Jahr 2000 wird die 50-jährige Herrschaft der chinesischen Kuomintang (KMT) beendet; seit 2016 regiert Tsai Ing-wen als erste Präsidentin den Inselstaat.
Wie soll frau schreiben über ein Land, das es also offiziell gar nicht gibt? Als Kennerin der Gesamtsituation wendet Alice Grünfelder einen klugen Kunstgriff an, der zunächst überrascht, doch der Realität erstaunlich gerecht wird. Sie veröffentlicht kein Geschichtsbuch und keinen Roman. Anhand von hundert alphabetisch angeordneten Stichpunkten fängt sie mit großen und kleinen Beobachtungen sowie Interviews (vor allem mit Frauen) Leben und Alltag des Inselreiches so facettenreich ein, dass die Informationen selbst in der Ferne Europas zu einem informativen Leseerlebnis werden. Erstaunlicherweise fängt das Panorama mit „Abschied“ an; über Bedrohung, Corona, Erdbeben, Gleichberechtigung, Jiaozi, Karaoke, Meer, Obdachlose, Qigong, Shilin, Tee geht es zu Trostfrauen, Weißer Terror, 2-28, und vieles mehr.
Die gut recherchierten, prägnant beschriebenen, manchmal auch sinnlich-verträumten Betrachtungen ergeben einen interessanten Einblick in die Gesamtsituation des Landes. So erinnert 2-28 an den 28. Februar 1947, als ein Generalstreik gegen die Gräueltaten der chinesischen Militärregierung das Land ins Chaos stürzte; das ausgerufene Kriegsrecht sollte bis 1987 anhalten. Neben solch tragisch-gewichtigen Ereignissen sind es vor allem alltägliche Zufälligkeiten, wie z. B. Radeln in der fahrradfreundlichsten Stadt Asiens, Taipei, oder eine „suchende Schildkröte“, die Stimmungen gekonnt einfangen und dem ganzen „gelebte Leben“ einhauchen.
Ganz besonderes Interesse verdient das Kapitel “Bedrohung“. 12 Frauen wurden hierzu befragt: Was können sie tun? Einige denken ans Auswandern, andere finden sich mit den Katastrophenwarnungen ab; das Militär – der chinesischen Dominanz durchaus bewusst – ist nur sehr begrenzt einsetzbar. Ob auf die Hilfe durch die USA gebaut werden kann, weiß niemand. „Sorge Dich nicht, es geht uns gut, es ist wie immer, früher war es einmal schlimmer“. Dieser Refrain wirkt auch auf die Autorin nicht wirklich beruhigend: „Ich habe keine Angst, weil mir schon früh klar war, dass man als einzelne Person nur wenig ausrichten kann“.
Weit entfernt vom Genre eines Nachschlagewerkes setzt bei der Lektüre der meist kurz gehaltenen Episoden – die ganz unabhängig voneinander gelesen werden können – fast ganz unbemerkt ein Lernprozess mit Erkenntnisgewinn ein, so dass sich durchaus ein flächendeckendes Puzzle des Inseldaseins ergibt. Wohl überlegt, informativ und hilfreich sind auch die im Anhang aufgeführte Geschichtschronik sowie die Zusammenstellung der verfügbaren Literatur zu Taiwan.
„Würden Sie sich noch ein Haus bauen“? fragt die Autorin an einer Stelle ihre Gesprächspartnerin. „Nein, wir müssen jeden Tag mit allem rechnen; bisher waren es Taifune, Überschwemmungen und Erdbeben, nun kommen noch die immer bedrohlicher werdenden Ankündigungen der Annexion durch China dazu“.
Angeregt durch die Lektüre verspüre ich – allen Widrigkeiten zum Trotz – große Lust, die weite Reise nach Taiwan anzutreten. Ich will nicht wieder zu spät kommen. Vor drei Jahren wollte ich meinen Plan realisieren, mit dem Zug nach Odessa zu fahren. Damals machte die Coronapandemie einen Strich durch die Rechnung. Und nun habe ich Angst, dass ich aufgrund der schrecklichen Kriegssituation in der Ukraine auch nicht mehr nach Taiwan komme – Anfang der 80er-Jahre war ich bereits dort –, also bevor der lauernde chinesische Drache die Insel verschlingt. Im Zeitalter grausamer Autokraten, denen jegliche demokratische Entwicklung als Bedrohung erscheint, die es zu vernichten gilt, schrumpft die kurzzeitig globalisierte Welt rapide zusammen. Alice Grünfelder schreibt mit „Wolken über Taiwan“ bewundernswert dagegen an.
Anna Gerstlacher
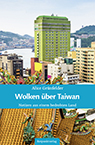
Wolken über Taiwan –
Notizen aus einem bedrohten
Land
Alice Grünfelder
Rotpunktverlag (2022)
260 Seiten, 28,00 €
Eine kulinarische Liebeserklärung
Babuschka, meine russische Oma nannte sie Piroggen. Von Vater kannte ich die mit Honig und gehackten Erdnüssen gefüllten fluffigen Teigtaschen als Baozi. Während meiner Zeit in Freiburg lernte ich sie in der Suppe als „Maultaschen“ kennen. Was für ein herzhafter Name! Als ob das Teil bereits in das geöffnete Mäulchen rutscht. In unseren globalen Zeiten bekommen die kulinarischen Teiglinge Wortspiel der Rezensentin) einfach einen internationalen Namen.
Unter dem Titel „Dumplings für alle!“ widmet sich der Band von Hugh Amano (Text) den asiatischen Teigtaschen. Auf über 200 Seiten werden alle möglichen Formen, Falttechniken und Füllungen der schmackhaften und sättigenden Teilchen vorgestellt. Die Geschichten ihrer Entstehung und die Vielzahl an Rezepten hat Sarah Becan (Illustration) gekonnt ins Bild gesetzt. Man sieht den farbenfrohen Illustrationen an, dass sie von der klassischen Comic-Kultur und dem Design von Graphic Novels mit der Liebe zu Mangas geprägt sind. Nach „Ramen für alle!“ ist es bereits die zweite Publikation, die von der engagierten Verlegerin Antje Kunstmann in Lizenz für ihren Münchner Verlag übernommen wurde.
Nach einem kleinen Einmaleins zu Ausstattung und notwendigen Küchengeräten zum Selbermachen von Dumplings geht es an die Kunst des Faltens: vom plissierten Halbmond zum vierzackigen Stern und den klassischen Wantans. Ein Abschnitt widmet sich den verschiedenen Formen der Zubereitung (Kochen, Dämpfen, Braten oder Frittieren). Den größten Teil des Buches nehmen die Erklärungen zu den Rezepten ein. Amano erklärt nicht nur, wie man die verschiedenen Dumplings macht, sondern auch, wie man sie isst. Zum Schluss werden die verschiedenen Saucen, Dips und Würzöle vorgestellt. Falls es nötig sein sollte, erfahren wir noch, wie übrig gebliebene Teiglinge aufbewahrt werden können.
Dann kann es losgehen. Ob gemeinsam mit Freunden oder allein: In die Kunst der Herstellung von Dumplings einzutauchen, wird Sie begeistern. Nur eine Warnung gibt es: Fangen Sie nicht an, wenn Sie noch nicht gegessen haben. Dann sausen Sie sofort zu Ihrem Lieblingslokal und futtern sich durch die Vielzahl der Teiglinge durch. Denn eins haben die Guotie, Siumai, Xiaolongbao, Baozi und Wantan gemeinsam: Sie schmecken alle lecker!
Dagmar Yu-Dembski

Dumplings für
alle! Ein
Kochbuch über asiatische
Teigtaschen
Hugh Amano & Sarah Becan
Verlag Antje Kunstmann
(2021)
208 Seiten, 24,00 €
Der Bildband ist tot – Es
lebe der Bildband!
Vom Reisen in Zeiten der
Coronapandemie
Die Coronapandemie hat die Welt, wie wir sie kannten, aus den Angeln gehoben. Wer hätte es für möglich gehalten, dass es einmal so schwer werden würde, Reisepläne zu schmieden, um Freunde und Familie zu besuchen oder um ferne Länder und Kulturen zu erkunden? Zeit, den Bildband wiederzuentdecken! Oftmals als „Coffee Table Book“ verschmäht, bietet er jetzt genau das, wonach wir uns sehnen: Futter für Auge, Hirn und Herz. Im Verlag teNeues sind in diesem Jahr drei besondere Bildbände erschienen, auf die wir hier gerne hinweisen möchten. Gute Reise!
Sabine Cikic
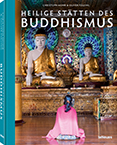
Heilige Stätten
des
Buddhismus
Christoph Mohr
& Oliver
Fülling
teNeues
(2021)
192 Seiten,
39,90 €
Gemeinsam mit dem Fotografen Christoph Mohr stellte sich Autor Oliver Fülling die Aufgabe, dem Leser/der Leserin den Buddhismus und seine verschiedenen Strömungen (hier: Theravada in den Ländern Thailand, Laos, Myanmar und Sri Lanka; Mahayana in China und Vietnam; Vajrayana in Tibet, Nepal sowie Zanskar und Ladakh) durch die Sprache der Bilder „erfahrbar“ zu machen. In ihrem Buch nehmen sie uns mit auf eine inspirierende Reise zu heiligen Stätten des Buddhismus in verschiedenen asiatischen Ländern. Dabei geben sie auch Einblicke in das buddhistische Alltagsleben sowie das Leben des historischen Buddha.

China –
Harmonie der
Farben
Annette
Morheng
teNeues
(2021)
176
Seiten, 39,90
€
Zweisprachig
Englisch/Deutsch
„Beim Reisen in China trifft man überraschend häufig auf Realität gewordene Gedichte oder Gemälde, auf Landschaftsszenen, die aussehen wie traditionelle Tuschemalerei in Grau-Weiß, mit etwas Glück mit einem Farbtupfer Rot“, so die Erkenntnis der Autorin Annette Morheng. In ihrem Werk „China – Harmonie der Farben“ lässt sie sich von Farben leiten und ergründet in Kapiteln wie „Von der Leuchtkraft der Farblosigkeit“, „Gelb erzeugt Yin und Yang“ oder „Der sanfte Farbverlauf der Sprache“ die chinesische Geschichte, Kultur und Traditionen. Bekanntes und Unbekanntes werden spannend verwoben und geben einen facettenreichen Blick auf Natur und Menschen im Reich der Mitte.

Innere Harmonie
– Leben im
Einklang
Jon
Kolkin
teNeues
(2021)
256 Seiten,
39,90 €
Mit Vorworten
des Dalai Lama und der
Königinmutter von
Bhutan
Das Leben buddhistischer Mönche und Nonnen hat der Arzt und Fotograf Jon Kolkin in 220 Aufnahmen dokumentiert. Über einen Zeitraum von 12 Jahren bereiste er zehn nicht nur asiatische Länder und besuchte Menschen, die den Frieden in sich selbst suchen. In eindringlichen Fotografien, meist in Schwarzweiß, fängt er Augenblicke der Stille ein. Den Kapiteln, die Namen tragen wie „Suche nach Einklang (…)“, „Geistige Offenheit (…)“ oder „Mitgefühl verkörpern (…)“ widmet man sich am besten mit Ruhe, denn Kolkins Bilder laden ein, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen.
„Als Künstler beschäftigte mich vor allen Dingen die Frage, auf welche Weise Menschen ein besseres Leben zu erlangen suchen – was von meiner ärztlichen Arbeit nicht so weit entfernt war. (…) Jedes Kapitel dieses Buches befasst sich mit grundlegenden, auf Wissenschaft basierenden Gedanken, die für das Erreichen eines ausgeglichenen Lebens zentral sind. Ich hoffe, dass Sie durch den Band Innere Harmonie: Leben im Einklang Anregungen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit Ihrem eigenen Lebensweg erhalten.“
Eine Liebe in Shanghai
–
Luo Lingyuan: Sehnsucht nach
Shanghai
Als Emily Hahn 1935 chinesischen Boden betritt, will sie eigentlich nur zwei Wochen bleiben. Sie möchte am liebsten das nächste Schiff besteigen und in ihr geliebtes Afrika fahren. Doch Shanghai verzaubert sie. Diese Stadt passt zu ihr. Mickey, wie sie von ihrer Familie und den Freunden genannt wird, liebt das ungebundene, aufregende Leben. Bereits als junge Frau hat sie gegen Konventionen rebelliert. In China wird die hübsche Amerikanerin, die sich mit ihren Reportagen für den „New Yorker“ einen Namen gemacht hat, eine leidenschaftliche Affäre mit einem kultivierten Chinesen aus bester Familie beginnen.
Mit dem Roman „Sehnsucht nach Shanghai“ lässt uns die Autorin Luo Lingyuan an dieser aufregenden Liebesbeziehung zwischen der selbstbewussten Emily Hahn und dem traditionellen chinesischen Intellektuellen Zao Sinmay teilnehmen. Luo, die ihre Jugend in Shanghai verbracht hat, lebt seit 1990 in Berlin. Sie hat seither erfolgreich mehrere auf Deutsch geschriebene Romane und Erzählungen (u. a. „Die chinesische Delegation“, „Die Sterne von Shenzhen“) veröffentlicht. Es war daher eine gute Entscheidung der Edition Ebersbach & Simon, Emily Hahns Liebes- und Lebensgeschichte in der Form eines Roman lebendig werden zu lassen.
Luo hat für ihr Buch auf eine Fülle von Originaldokumenten und ins Chinesisch übersetzte Texte zurückgreifen können. Mit Einfühlungsvermögen und der Lust am Fabulieren ist ihr ein eindrucksvoller Blick in die Gefühlswelt der Protagonistin gelungen. Frei von allzu einengenden Vorgaben klassischer Biografien konnte Luo erzählerische Schwerpunkte setzen, individuelle Charaktermerkmale hervorheben und den Akzent auf die leidenschaftliche Liebesbeziehung setzen.
Es sind vor allem die Dialoge, die dem Roman seine authentische Atmosphäre liefern. Gekonnt hat Luo die Chance erzählerischer Freiheit genutzt, um die widersprüchliche Gefühlswelt ihrer Protagonistin zu illustrieren. Auf diese Weise ist ihr ein Porträt gelungen, das neben einer unkonventionellen Liebe den Blick auf die politische Situation der Stadt und ihre Einwohner lenkt.
Der Roman erzählt noch mehr. Wie Emily Hahn mit Hilfe ihres chinesischen Geliebten ein literarischer Coup gelingt: das Buch über die drei Soong-Schwestern, Chinas führenden Persönlichkeiten der Nationalpartei. Mit dem Bericht über die langwierige Arbeit am Buch und dem monatelangen Aufenthalt in Chongqing während des japanischen Kriegseinfalls geht „Sehnsucht nach Shanghai“ weit über die Schilderung einer Liebesstory hinaus. Luo ist es gelungen, in der Figur Emily Hahns eine moderne, selbstbewusste Frau zu zeichnen, die in politisch schwieriger Zeit allen Unwägbarkeiten des Lebens trotzt. Das ist vermutlich der Grund, weshalb ihre Lebensgeschichte auch ein heutiges Lesepublikum zu faszinieren vermag.
Dagmar Yu-Dembski

Luo Lingyuan: Sehnsucht
nach Shanghai
Ebersbach & Simon
(2021)
320 Seiten, 24,00 €
Dieser Artikel wurde erstmals in „das neue China“, Heft 3/2011 veröffentlicht.
Mitternacht in Peking –
Die Geschichte einer Tat, die
erst jetzt geklärt wurde
Manchmal sind es die eigenartigsten Zufälle, die Nebensachen, die oft übersehen werden, die eine lang vergessene Geschichte wieder in Bewegung setzen. So ging es vor ein paar Jahren dem britischen Historiker, Journalisten und Autor Paul French, der seit über 17 Jahren in Shanghai lebt und fasziniert von der Stadt, ihrem Mythos als kosmopolitischer Treffpunkt, die abseitigen Geschichten seiner Bewohner, der Abenteurer und Glückssucher, recherchiert und aufgeschrieben hat.
Sein jüngstes Buchprojekt begann vor sieben Jahren. Als Abendlektüre hatte er eine Biographie des amerikanischen Journalisten Edgar Snow gelesen, dem Autor von „Red Star over China“, ein Buch, das er eigentlich nur mäßig interessant fand – bis er an einer Stelle einen überraschenden Hinweis entdeckte, eine keineswegs politisch bedeutsame Information. Sie betraf seine damalige Frau Helen Foster Snow, mit der er in den dreißiger Jahren in Peking in einer kleinen Gasse ganz in der Nähe des Gesandtschaftsviertels gewohnt hatte. In den Fußnoten hieß es, Helen sei ein bisschen ängstlich. Eine junge Engländerin, die nur einige Häuser weiter gewohnt hatte, war brutal ermordet worden.
Die Presse hatte sich sofort auf die Geschichte gestürzt und allerlei Vermutungen über die Hintergründe angestellt. Die Tat und das Tatmotiv waren äußerst mysteriös und nie geklärt worden. Es gab allerlei Gerüchte. Da war ein Detektiv von Scotland Yard, der nicht suchen durfte, ein Schuldirektor eines Gymnasiums, der ganz plötzlich nach England zurückkehren musste, und offenbar war Sex im Spiel. Es gab jede Menge dunkle Geheimnisse. French war überrascht und dachte: „Wie kann jemand ein derart langweiliges Buch schreiben, und das einzig wirklich Aufregende einfach in eine Fußnote stecken.“
(Wo French genau diese Fußnote gefunden hat, bleibt unklar. Vielleicht ist es ein besonders gelungener Marketingtrick, um die Geschichte spannender zu machen. Den entsprechenden Hinweis auf die Mordtat habe ich leider noch nicht finden können.) Helen war seit 1932 mit Edgar Snow verheiratet, und eigentlich nicht besonders ängstlich. Sie fuhr oft abends mit dem Fahrrad durch die Stadt, aber ein Mord an einer Weißen, einem jungen Mädchen von 19 Jahren, das zudem grausam zugerichtet worden war, das hatte sie offenbar doch beunruhigt, zumal sie der Meinung war, der Anschlag habe eigentlich ihr gegolten. Nach der abendlichen Lektüre hatte French das Buch weggelegt. Doch irgendwie hatte sich diese Information bei ihm über Nacht festgesetzt. Und als er am nächsten Morgen aufwachte, wusste er, er würde dieser Sache nachgehen.
Er begann seine Suche in den Archiven von Shanghai, Peking, Hongkong und London, wo er die Presse aus dieser Zeit durchforstete. Jeder neue Hinweis auf die damaligen Umstände des Mordes machte ihm klar, dass er es dem Opfer schuldig war, diese Tat aufzuklären. Der entscheidende Durchbruch kam, sein Heureka, wie er es nannte, als er an einem kalten Londoner Tag in dem Zeitungsarchiv der British Library im Zusammenhang mit dem Mord ein Foto von Pamela Werner fand. Für ihn stand fest, dass er diese Geschichte aufschreiben musste. Denn so sehr sich die Fakten zunächst wie ein ungelöster Kriminalfall im Peking der 30er Jahre anhörten, so war es doch viel mehr: das Portrait einer Stadt mit ihren dunklen Seiten, in der Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft nebeneinander und miteinander lebten, mit kaum überwindbaren Schranken zwischen einer ausländischen Community, die ihre eigenen Rechte beanspruchte in ihrem Gesandtschaftsviertel, und den chinesischen Bewohnern der „Tatarenstadt“, getrennt durch ein Stadtgebiet, das Badlands genannt wurde, eine Art Pufferzone, in dem Menschen aller Couleur ihren meinst dunklen Geschäften nachgingen. In den schummrigen Tanzlokalen, schmierigen Bars und Absteigen waren Prostituierte aus Korea und Weißrussland ebenso billig zu haben wie die minderjährigen Strichjungen. Ein Stadtviertel, in dem skrupellose Dealer Opium, Kokain und alle möglichen anderen Drogen an ihre zahlende Kundschaft lieferten, und Gauner und Betrüger die Nacht zum Tag machten. Hier verkehrten die Herren der ehrenwerten Gesellschaft, wenn sie in der Sicherheit des Dunkels ihren abseitigen Neigungen nachgingen.
Es gelang French recht bald, den Bericht des Pathologen einzusehen, der den Leichnam der jungen Frau obduziert hatte. Es waren die schrecklichen Details dieser Untersuchung, die French zeigten, dass es nicht nur in Shanghai, sondern auch in dem geordneten Peking eine dunkle Seite gab, von der nichts in den offiziellen Berichten der damaligen Zeit zu finden war.
Pamela war die Adoptivtochter eines in der Fachwelt äußerst anerkannten britischen Sinologen und früheren Diplomaten. Edward T.C. Werner hatte sich jedoch aufgrund seines cholerischen Charakters, und weil er sich in einem gewissen Hochmut von den üblichen Zusammenkünften des diplomatischen Dienstes ferngehalten hatte, besonders jegliche Umgangsformen des höheren Dienstes mit den üblichen Trinkgelagen ablehnte, allerlei Feinde gemacht. Er und seine Frau hatten Pamela als Baby aus einem Pekinger Waisenhaus geholt und adoptiert, vermutlich war sie das unerwünschte Kind einer überforderten Weißrussin gewesen. Denn auffallend war Pamelas graugrüne Augenfarbe.
Die junge Frau hatte ihre Adoptivmutter, die unter nie ganz geklärten Umständen sehr jung gestorben war, nie richtig kennengelernt. Nach dem Tod seiner Frau war Werner nicht nach England zurückgegangen und hatte für sich und die Tochter ein großzügig geschnittenes, modernisiertes Haus außerhalb des Gesandtschaftsviertels in der Kuijiachang Gasse gemietet. Werner, der zum Zeitpunkt des Mordes bereits 72 Jahre alt war und noch zeitweise an der Peking Universität arbeitete, hatte sich all die Jahre seinen sinologischen Forschungen gewidmet und Pamela sich mehr oder weniger selbst überlassen. In der Obhut der chinesischen Hausangestellten hatte sie einen eigenwilligen, unabhängigen Charakter entwickelt. Für ein junges weißes Mädchen hatte sie jede Menge Freiheiten erhalten und war mit dem Leben in den chinesischen Vierteln der Stadt genauso vertraut wie dem Zuhause ihrer britischen Freundinnen. Allerdings hatte sie mehrfach wegen Aufsässigkeit die Schulen wechseln müssen und war zuletzt auf einem Internat in Tianjin zur Schule gegangen. Auf dem Foto von 1936 trägt sie die Schuluniform, eine Art Schürzenkleid über einer weißen Bluse mit bravem Rundkragen und derben schwarzen Sportschuhen; sie sah aus wie eine etwas pummelige Oberschülerin. Das in Peking angesagtem Studio vor einem Art Déco-Vorhang aufgenommene Foto, das die Titelseiten der internationalen Presse über den aufsehenerregenden Fall bebildern sollte, zeigte dagegen eine ganz andere Pamela: Eine elegante junge Frau in einem schmal geschnittenem, eng am Körper sich anschmiegendem Abendkleid, im Aussehen dem modischen Vorbild eines glamourösen Filmstars ähnlich, einer Garbo oder Claudette Colbert, wie sie in den aktuellen Filmen gezeigt wurden. Es waren diese gegensätzlichen Bilder von Pamela Werner, die den unerklärlichen Mord so geheimnisvoll machten.
Jahrzehntelang hatte nicht geklärt werden können, was in dieser frostigen Winternacht zwischen Mitternacht und Morgen genau passiert war. Am frühen Morgen des 8. Januar 1937 hatte ein alter Mann den Leichnam gefunden, als er mit seinem preisgekrönten Vogel im Käfig wie jeden Morgen nahe der Pekinger Stadtmauer spazieren ging. Die Tote hatte gar nicht so weit entfernt von ihrem Haus, der Kujiachang Gasse (Armour Factory Alley), an der südöstlichen Ecke der Stadtmauer gelegen, im Schatten eines Wachsturms, der bei den Einheimischen nur Fox Tower hieß und über den es jede Menge unheimliche Geschichten gab: von Fuchsgeistern, die nach der chinesischen Mythologie sich der Gestalt hübscher Frauen bedienen, um Männer anzulocken, sie in die Irre zu führen und zu verführen. Diese Fuchsfeen haben magische Kräfte, mit denen sie die Männer ihrer Manneskraft berauben, sie belügen und betrügen, auch wenn sie ewige Treue schwören. Es wurde gemunkelt, diese Geister lebten auch im Fox Tower, wo sie unschuldigen Menschen auflauerten, um sie zu töten. Daher wurde diese unheimliche Ecke außerhalb des Gesandtschaftsviertels von den Chinesen gemieden. Es war eine Gegend, die nachts menschenleer und verlassen war, wo in dem dunklen Gemäuer jede Menge Fledermäuse hausten und die berüchtigten verwilderten gelben Hunde auf der Suche nach Fressbarem selbst die Mutigsten in die Flucht schlugen.
Kaum war die zuständige Stadtpolizei benachrichtigt worden, fanden sich die ersten Journalisten ein, versuchten Fotos zu machen und Informationen zu erhalten. Da der Fundort außerhalb des britischen Gesandtschaftsviertels lag, war die chinesische Polizei verantwortlich. Andererseits war das Opfer Engländerin, so dass auch die Briten um Aufklärung bemüht waren. So kam es zu der überraschenden (und einmaligen) Zusammenarbeit zwischen der Pekinger Dienststelle, einem Kommissar Thomas, und dem Scotland Yard Detektiv Dick Dennis, der aus Tianjin gerufen worden war.
Es ist besonders die Persönlichkeit von Dennis, der sich French widmet, und die er in seinem Buch als tragische Figur zeichnet, der von den britischen Behörden an der Aufklärung des Falls gehindert wurde. Es war ein Netz von bewusster Behinderung und unglücklicher Umstände: Wichtige Zeugen wurde nicht gehört, die Untersuchung wurde nur in eine Richtung geführt. Es gab persönliche Aversionen und nach der Besetzung der Stadt durch die japanische Armee gerieten die Ereignisse um den Mord an Pamela Werner immer mehr in den Hintergrund. Nach einigen Wochen waren das Opfer und die grausamen Umstände der Tat auch für die Journalisten kein Thema mehr. Nur Werner, Pamelas Vater, der selbst in Verdacht geraten war, ließ das Schicksal seiner Adoptivtochter keine Ruhe.
Letztlich gab er sein ganzes Vermögen aus, heuerte Detektive an und ließ sie Zeugen suchen, um minutiös den letzten Nachmittag und Abend vor dem Mord rekonstruieren zu können. Seine Informationen, die Indizien und die Zeugen, die er inzwischen hatte aufspüren lassen, und die sogar bereit waren auszusagen, wurden nicht anerkannt. Überhebliche Beamte im diplomatischen Dienst waren nicht daran interessiert, Licht in das Dunkel zu bringen. Zu brisant wäre eine Aufklärung für das Ansehen der Untertanen seiner königlichen Majestät gewesen.
Als Werner in Peking kein Gehör fand, ließ er schließlich alle Unterlagen nach London schicken, wo sie jahrzehntelang, auch in Europa war inzwischen der Krieg ausgebrochen, unentdeckt in einem Dutzend Kartons im Zeitungsarchiv der British Library lagerten. Hier entdeckte sie Paul French, es war die Verbindung, es war das Stück eines Puzzles, das gefehlt hatte, um den Mord endlich aufklären zu können. Es gab 150 Hand geschriebene Briefe, in denen Werner die Erkenntnisse seiner Recherchen immer und immer mitgeteilt hatte, minutiös und präzise zusammengestellt aufgrund der Recherchen seiner Detektive. Wie es zu der Tat kam und wer die Täter waren, soll an dieser Stelle nicht verraten werden.
Paul French fand, er musste dieses Buch schreiben. Um einem jungen unschuldigen, bestialisch ermordeten Mädchen ein Stück seiner Würde zurückzugeben. Dieses Buch ist aber weitaus mehr. Es zeigt den Verfall einer Gesellschaftsschicht, die angesichts ihres Glaubens an die eigene moralische Überlegenheit, unfähig war, ihre Tat zu gestehen, und die Vorboten des notwendigen Aufbruchs in eine neue Zeit. Das Buch, das im Frühjahr 2011 herausgekommen ist, wird inzwischen in 15 Sprachen übersetzt. Für die chinesische Fassung wird der Autor, wie er während seiner Lesung in Peking erklärte, einige Veränderungen vornehmen, da viele historische Zusammenhänge für ein chinesisches Lesepublikum als bekannt vorausgesetzt werden können. Während seines Aufenthalts in Peking hat French auch mitternächtliche Spaziergänge zu den Orten des Verbrechens, u. a. dem Fox Tower (heutige Dongmianmen) und dem Haus der Werners in der nahegelegenen Gasse durchführt.
Dagmar Yu-Dembski
Midnight in Peking
Paul French
Penguin Books
(Australia) in
cooperation with
Penguin Books Beijing
(2011), 278 Seiten
Der Traum vom Goldenen Berg
ist ausgeträumt –
Ein Film und ein Roman
Vielleicht ist es ein Zufall. Der Blick auf das Amerika der Eingewanderten hat sich gewandelt. Sie blicken auf die Geschichte zurück, eine ferne Vergangenheit und ein zerstörtes Erbe. Es ist immer noch das Land ihrer Zukunft, aber nicht mehr der Weg zum Goldenen Berg. Ihr Blick richtet sich auf ein anderes Land, das ein Stück der Geschichte seiner Bewohner, eingewanderter wie einheimischer, nicht mehr sieht.
Es war eine Überraschung, dass die junge in China geborene Chloé Zhao für ihren Spielfilm „Nomadland“ in diesem Jahr mit dem Oscar prämiert wurde. Die bereits in Venedig und auf verschiedenen Festivals 2020 aufgeführte Produktion führt uns mit den Augen einer Einwanderin und dem Gesicht der wunderbaren Schauspielerin Frances McDormand durch ein Amerika, das alle Freiheiten bietet – auch die, „homeless“ zu sein. Nicht obdachlos, nur wohnungslos.
Und es sind viele. Sie sind nicht auf der Suche nach einem Zuhause, nach einer Heimat. Amerika ist ihr Land. Nur das System des „immer mehr“, auf Kosten der Natur und der Menschen, lässt ihnen keine Chance. Nachdem in der Bergbaustadt Empire, Nevada die Gipsproduktion keinen Gewinn mehr macht, wird das Unternehmen geschlossen. Die Frauen und Männer verlieren ihre Arbeit, verlassen ihre Häuser. Der Ort wird zur Geisterstadt. Schließlich wird sogar die Postleitzahl gelöscht.
Fast dokumentarisch verfolgen wir – einem Roadmovie gleich – die 60-jährige Fern (Frances McDormand) auf ihrem Weg durch den Westen der Vereinigten Staaten, in die Weite einer großartigen, fast menschenleeren Landschaft. Begleiten sie zu ihren Leiharbeitsjobs, ob in ein Amazon-Center oder einen Schnellimbiss. Egal wo: Randexistenzen, Billigarbeit.
Chloé Zhao zeichnet ein Land von unendlicher Schönheit, großartigen Naturlandschaften, voller liebevoller menschlicher Wärme und Solidarität, doch von Verfall und Vernichtung umgeben. „Nomadland“ ist wegen überlanger Bildstrecken, einer eher konventionellen Filmsprache und bis an die Grenze zum Kitsch gezeichneter menschlicher Begegnungen kritisiert worden, und doch zeigen die Gesichter all der (Laien-)Darsteller und allen voran Frances McDormands trotz aller Poesie eine Welt, die sich in ihrem Wahn nach mehr selbst vernichtet.

Nomadland (2020)
Regie: Chloé Zhao
Drehbuch: Frances
McDormand & Chloé
Zhao
107 Minuten

Wie viel von diesen
Hügeln ist Gold.
Roman
C Pam Zhang
S. Fischer Verlag
(2021)
352 Seiten, 22,00 €
Auch C Pam Zhang, 1990 in Peking geboren und im Alter von vier Jahren mit ihren Eltern nach Amerika gekommen, blickt auf das Goldene Land. Doch anders als Zhao bohrt sie sich tief in die Vergangenheit ihrer neuen Heimat ein, bringt die vergessene Zeit der Bisons, Schakale, seiner einstigen Einwohner, der Abenteurer, Goldsucher und Minenarbeiter an die Oberfläche. In ihrem Debütroman erzählt sie eine andere Seite des amerikanischen Aufbruchs, der so brutal und schonungslos ist wie die Sprache in ihrem Debütroman.Zhang lässt die jugendlichen Geschwister Sam und Lucy durch ein Land ziehen, dem sein Gold genommen wurde, seine Flüsse, seine Tiere, sein Grün, seine Lebenskraft – vor langer Zeit, als die neuen Männer kamen, die Kugeln statt Samen säten. Als von jenseits des tiefblauen Meeres Frauen und Männer in dieses Land gebracht wurden. Sie waren billig gekauft, wurden eingepfercht und gefangen gehalten, um die Zivilisation aus dem Osten in den Westen zu bringen, den Bau der Eisenbahn quer durchs Land zu ermöglichen.
Sie sprachen eine unbekannte Sprache und Männer wie Frauen hatten langes schwarzes Haar, das zu einem Zopf gebunden werden konnte. Sie hatten Augen wie Sam und Lucys Ma, die nur vom Gold träumte und der Rückkehr über das Meer. Die Eltern waren wie Yin und Yang. Ba liebte dieses wilde Land, er schuftete in den Minen, schürfte heimlich nach Gold, um ein Stück Land zu kaufen. Für ein Zuhause. Er hat nie erfahren, dass nur ein Stück Papier, eine Urkunde, über den rechtmäßigen Besitz des Goldes entscheidet. In der verkommenen Hütte, mehr dreckiger Hühnerstall als Heim, bleibt den Kindern eines Tages nur noch der Leichnam des Vaters. Seine Überreste müssen begraben werden. Ba braucht ein Zuhause, von Erde und schweren Silberdollars bedeckt, damit die Geister Ruhe finden.
Dagmar Yu-Dembski
Veranstaltungshinweis: C Pam Zhang ist im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals Berlin (ILB) am 13. September um 21.00 Uhr im Silent Green eingeladen.
Melancholie des ewigen
Abschieds –
Eileen Chang: Die
Klassenkameradinnen
Ihr Leben war eine endlose Folge von Abschieden. Sie musste immer wieder ihre Geburtsstadt Shanghai verlassen. 1952 zog Eileen Chang nach Amerika, blieb dort, bis zu ihrem einsamen Tod 1995. Obwohl sie nie mehr nach China zurückkehrte, blieb die Erinnerung an das Shanghai ihrer Jugendzeit im Zentrum all ihrer Erzählungen. Dabei konnte sie keineswegs auf eine glückliche, behütete Kindheit zurückblicken.
Eileen Chang (1920–1995), mit ihrem chinesischen Namen Zhang Ailing (张爱玲), hatte nie ein sicheres Zuhause. Die wohlsituierte Familie, die auf Vorfahren in kaiserlichen Diensten verweisen konnte, lebte während der Dreißigerjahre in einer großbürgerlichen Villa im französischen Stadtteil Shanghais. Ihre Mutter, getragen von Ideen der 4.-Mai-Bewegung 1919, verließ Eileen, um in Europa zu studieren. Die Tochter blieb bei dem Vater, der ein klassisch gebildeter Chinese, doch im Gegensatz zu der Mutter ganz der Tradition verhaftet war. Unter seiner Opiumsucht, den ständig wechselnden Konkubinen im Haus und einer feindseligen Stiefmutter litt das sensible junge Mädchen sehr. Die familiären Konflikte eskalierten, als der Vater sie in seiner Eifersucht schlug, wochenlang im Haus einsperrte und ihr sogar, als sie lebensgefährlich erkrankte, die medizinische Betreuung verweigerte.
Mit Hilfe ihres Kindermädchens konnte sie schließlich aus dem väterlichen Heim zu ihrer Mutter fliehen, die sie jedoch kurz darauf erneut verließ und nun nach Paris ging. Durch Vermittlung ihrer Mutter – und den vorhandenen finanziellen Mittel der Familie – konnte Eileen das angesehene St. Mary’s Mädcheninternat besuchen. Trotz der überaus strengen allgemeinen Schulordnung und des wenig kreativen Unterrichts war diese Zeit für sie prägend, wie die jetzt veröffentlichte Erzählung „Die Klassenkameradinnen“ zeigt. Dort entdeckte Eileen Chang ihre Begeisterung am Schreiben, es entstanden ihre ersten Kurzgeschichten für die Internatszeitung.
Nach Abschluss der Schulzeit konnte sie während der kriegerischen Auseinandersetzungen das Stipendium für Europa nicht wahrnehmen. Daher ging sie für drei Jahre zum Studium nach Hongkong, kehrte jedoch 1941 in ihre Heimatstadt zurück und begann, für lokale Zeitschriften kleinere Prosatexte zu schreiben. Mit den einfühlsamen Schilderungen zwischenmenschlicher Beziehungen und alltäglichen Geschichten vom Scheitern mancher Träume avancierte sie in den Vierzigerjahren zum aufregenden Star der Literaturszene. Ihre kurze, unerfreuliche Ehe mit Hu Lancheng, der während des Krieges mit dem japanischen Besatzungsregime kollaborierte, sollte ihre Karriere als Schriftstellerin im kommunistischen China auf Jahre hinaus belasten.
1952 verließ sie für immer ihre Heimat, ging zunächst nach Hongkong, wo sie als Dolmetscherin arbeitete und verschiedene westliche Autoren übersetzte. Sie verließ auch diese Stadt, ging in die USA, wo sie als Dozentin an mehreren Hochschulen unterrichtete und einen großen Teil ihrer Romane, Essays und Erzählungen auf Englisch schrieb. Ihre Ambivalenz ihrer literarischen Arbeit zeigte sich darin, dass sie die Texte immer wieder änderte, umarbeitete, kürzte und aus dem Englischen auch ins Chinesische rückübersetzte.
In der nun erschienenen längeren Erzählung gibt die Autorin zum ersten Mal genauere Einblicke in ihr Leben in Amerika. In der Figur der Zhao Jue erfahren wir von dem schwierigen Leben als Emigrantin und ihren demütigenden (heute als Me-too) Erfahrungen bei der Vergabe von Aufträgen als Simultandolmetscherin. Dies ist vermutlich auch der Grund dafür, dass die 1978 verfasste Langerzählung zum Schutz noch lebender Personen nicht zu ihren Lebzeiten veröffentlicht werden durfte. Der Text war zuerst 2004 in Taiwan unter dem Titel 我同学少年都不见 (Wo tongxue shao nian bu jian) erschienen und wurde jetzt vom Ullstein-Verlag herausgegeben; gewohnt kompetent von Susanne Hornfeck und Wang Jue ins Deutsche übertragen und mit einem überaus informativen Nachwort versehen.
Die Erzählung beginnt damit, dass Zhao Jue – das Alter Ego der Autorin – einen Artikel im Time-Magazin entdeckt und sich nach all den Jahren an ihre Jugendfreundin aus der Internatszeit in Shanghai erinnert. Ihre Gedanken kehren zurück an ihre uneingestandene Liebe zu Enjuan, an ihre schwärmerische Bewunderung der Freundin, die aus einfachen Verhältnissen kommt, an Gefühle von homoerotischer Anziehung und Eifersucht. Präzise sind die Erinnerungen an unbefangene Sonntage eingefangen, an vertraute Treffen in dem verwilderten Park des Internats, wo die Freundinnen ihr Wissen über Sex und Liebe austauschen. Nicht immer wagt Jue sich der Freundin zu nähern, beobachtet eifersüchtig das Zusammensein anderer Schulkameradinnen mit der umschwärmten Freundin. Ihr bleibt die Gewissheit der wahren Liebe, einer Liebe ohne Ziel.
Die Wege der früheren Freundinnen trennen sich, sie heiraten. Enjuan folgt ihrem Mann in die USA, wo sie nun als Frau eines Diplomaten gesellschaftlich aufsteigt. Dagegen bleibt Zhao Jue nach ihrer Scheidung in Amerika nur ein glückloses, einsames Leben. Zehn Jahre lang haben die früheren Schulfreundinnen nicht miteinander kommuniziert, selbst bei dem Wiedersehen kehrt die einstige Vertrautheit nicht zurück.
Wer will, kann in jeder Zeile die Melancholie der Autorin über den Verlust ihrer einstigen Welt nachempfinden. Im Gegensatz zu der glamourösen Zeit der 1940er-Jahre führt sie in Amerika ein finanziell bedrückendes und einsames Leben als Emigrantin. Lange Jahre war sie als Autorin verfemt und fast vergessen. Erst mit „In the mood for love“, der virtuosen Verfilmung von „Lust, Caution“ durch den Hongkonger Filmemacher Wong Karwai, wurde Zhang Ailing weltweit wieder entdeckt. Ihre Romane und Erzählungen wurden nun in zahlreichen Sprachen veröffentlicht. Mit ihren Geschichten einer verlorenen Zeit hat sie die Erinnerungen an das urbane Leben und die Menschen vor dem Vergessen bewahrt.
In den 1970er-Jahren erschienen in Taiwan und Hongkong, später auch in China, einige ihrer Erzählungen und Romane der Vierzigerjahre. Ihr Leben endete dennoch, literarisch fast vergessen und einsam. Sie wurde im September 1995 tot in ihrem Appartement in Los Angeles gefunden. Eileen Chang erweist sich in der Melancholie des ewigen Abschieds nun wieder als großartige, unvergessene Literatin der chinesischen Moderne.
Dagmar Yu-Dembski

Eileen Chang: Die
Klassenkameradinnen
Ullstein Verlag
(2020)
96 Seiten, 18,00 €
Einsichten eines
politischen Journalisten –
Theo Sommer: China First
Der Titel war natürlich bewusst gewählt: China First. Vor einem Jahr veröffentlichte der promivierte Politologe und Publizist Theo Sommer auf über 300 Seiten (plus Literatur und Register) seine Einsichten und Überlegungen zur weltpolitischen Rolle Chinas im 21. Jahrhundert. Vor dem Hintergrund zeithistorischer Entwicklungen des Landes werden in dem vom Verlag C.H.Beck herausgegebenen Band globalstrategische Projekte und Konzepte vorgestellt. Die Berichte und Kommentare dienen Sommer als Beleg für Chinas Weg zur Weltmacht, der bestimmt wird von der Konkurrenz zu den USA und der „America First“-Politik seines Präsidenten Donald Trump.
Der langjährige Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung „Die Zeit“ versteht seine Veröffentlichung ausdrücklich als Aussagen eines Journalisten, der sich seit fast 60 Jahren mit Asien und Weltpolitik befasst hat, und nicht eines Sinologen. Da er nicht als Korrespondent oder Berichterstatter länger im Land gelebt hat, dienen ihm u. a. die eigenen Berichte und Begegnungen mit chinesischen Politikern zur Beurteilung politischer, sozialer und ökonomischer Entwicklungen der Volksrepublik als Grundlage.
Eine wichtige Chinaerfahrung war 1975: Sommer nahm als journalistische Begleitung von Helmut Schmidt an einem Staatsempfang mit Deng Xiaoping in Peking teil. In diesem Kontext entstand der Band „Die chinesische Karte“, in dem seine grundlegenden Überlegungen zur zukünftigen Bedeutung Chinas bereits angelegt waren. Angesicht der raschen globalen und innerchinesischen Entwicklungen sind weite Teile von Sommers jetzigen Ausführungen teilweise überholt. Dies liegt daran, dass der Autor zwar auf eine Fülle an Belegen wie Pressematerial, Berichte und Kommentare seiner Kollegen verweisen kann, diese Texte – wie seine eigenen – jedoch im aktuellen Zusammenhang entstanden sind. Viele der gesammelten Informationen sind bereits früher publiziert worden und in der nun veralteten Aussage wenig bedeutsam.
Sommers Text richtet sich
allerdings vorwiegend an ein
allgemein politisch
interessiertes Lesepublikum. So
gewinnt die Darstellung durch
eine „medienwirksame“ Sprache,
die komplexe Zusammenhänge
durch personalisierte
Charakterisierungen und
persönliche Einschätzungen
belebt.
Dieser Ansatz führt zu der
ambivalenten Bedeutung des
Bandes „China First“, in dem
der Autor Chinas Entwicklung
zur wirtschaftlichen Weltmacht
von der Reformpolitik Deng
Xiaopings bis zur
machtpolitischen Festigung
durch Xi Jinping verfolgt.
Neben kritischen Ausführungen
zu außenpolitischen Strategien
(Seidenstraßen-Projekt,
Gebietsansprüche) und
Spannungsfeldern (Taiwan,
Indien, Japan) sowie den
innenpolitischen
Einschränkungen werden
Möglichkeiten einer
deutsch-chinesischen
Zusammenarbeit angesichts
globaler handelspolitischer
Auseinandersetzungen (Trump –
Xi) und geostrategischer
Konflikte diskutiert. Als Fazit
zieht Theo Sommer statt einer
Politik des „China First“ eine
Zukunft, die von dem Konzept
„Together First“ geprägt sein
sollte.
Dagmar Yu-Dembski

Theo Sommer: China
First –
Die Welt auf dem Weg
ins chinesische
Jahrhundert
Verlag C.H.Beck (2020,
Taschenbuch-Ausgabe)
496 Seiten, 16,00 €